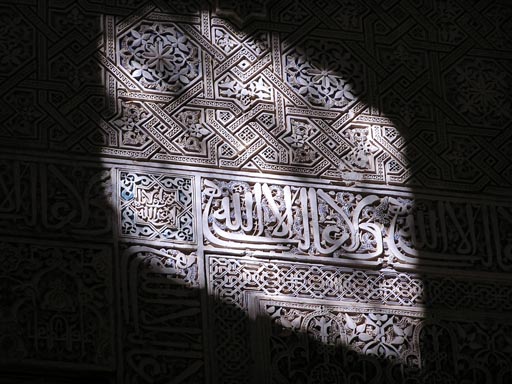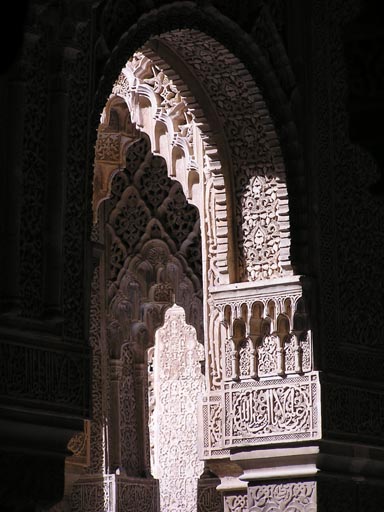Spanien: GeschichteGeschichte Spaniens in chronologischer Reihenfolge. Ergänzungen zur lokalen Geschichte der einzelnen Regionen Spaniens, z.B. der Balearen oder den Kanarischen Inseln, findet man auf den Regionalseiten.
|
Auf dieser Seite:Auf separaten Seiten: |
Allgemeines, Inhalt, Gliederung |
| Die Geschichte Spanien ist ausgesprochen vielschichtig und interessant. Kelten, Iberer, Römer, Westgoten, Mauren, Habsburger, Bourbonen, Franco und die Demokratie - Katalanen, Basken, Galizier, Andalusier ... die Durchdringung des Landes mit den unterschiedlichsten kulturellen und politischen Einflüssen ist noch heute präsent. Um Spanien zu verstehen, muss man seine Geschichte verstehen. Sonderthemen |
Stichworte - Überblick |
|
Literatur zur Geschichte Spaniens |
|
Vorgeschichte |
| 60.000 Jahre v. Chr.: Neandertaler leben nachweislich in einer Höhle in Gibraltar. 20.000 Jahre v. Chr.: Höhlenmalereien entstehen in der Höhle La Pileta nahe Ronda und in einer Höhle nahe Nerja, beide in der Provinz Málaga in Andalusien. um 16.000 v. Chr.: Entstehung von Höhlenmalereien des Homo Sapiens in der Höhle von Altamira bei Santillana del Mar in Kantabrien, wo mehr als 150 Wandbilder zu sehen sind. Besiedlung der Höhlen von Ekain und Altxerri, beide in der Nähe von San Sebastián im Nordosten der Iberischen Halbinsel. Dort fanden Archäologen eine Reihe von Gravierungen und Wandmalereien und bisher mehr als 300 Artefakte, vor allem Werkzeuge aus Stein oder Knochen, Die ältesten sind zwischen 16.500 und 15.500 Jahre alt und der frühen Magdalénien-Epoche zuzuordnen. ab 6.500: Die Impressokultur bringt das Neolithikum (Jungsteinzeit) auf die Halbinsel.
ab 6.000 v. Chr.: Die jüngsten in der Cueva La Pileta (bei Ronda, Andalusien) gefundenen Wandmalereien wurden im 6. Jahrtausend v. Chr. angefertigt. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen Malereien in der Höhle Cueva de los Letreros bei Vélez Blanco (Almería, Andalusien) und Grabbeigaben - Goldschmuck und gewebte Stoffe - aus der Höhle Cueva de los Murciélagos (Granada, Andalusien). ab 3.000 v. Chr.: Bei Antequera (Málaga, Andalusien) liegen die beiden bronzezeitlichen Dolmen Cueva de Menga und Cueva de Viera (2.500 v. Chr.). Sie gehören zu mehreren Tausend ähnlicher Anlagen auf der Iberischen Halbinsel und zu den größten Dolmen Europas. Sie wurden von den Nachfolgern der Impressokultur erbaut. Etwas außerhalb von Antequera befindet sich der Dolmen el Romeral aus dem frühen 2. Jahrtausend v. Chr. (ca. 1800 v. Chr.). |
Frühgeschichte und Römer |
|
Westgoten (ab 409) |
Zu Beginn des 5. Jahrhunderts (um 409), als der innere Zerfall des Römischen Reichs auch seine äußere Macht erschütterte, drangen die germanischen Völker der Vandalen und Sueben in Spanien ein und verwüsteten das Land. Einige wurden sesshaft und gründeten kurzlebige Nachfolgekönigreiche der Römer, die sich noch eine Zeitlang im Osten der Halbinsel behaupten konnten. Ein suebisches Königreich in Galicien hatte bis ins späte 6. Jahrhundert Bestand. Der Landschaftsname Andalusien (Vandalusien) weist möglicherweise auf die Vandalenbesetzung hin. Die Iberische Halbinsel wurde in den Jahren um 470 von den Westgoten erobert, die zuvor noch als Bundesgenossen der Römer gekämpft hatten und im südwestlichen Gallien angesiedelt worden waren. Hauptstadt des Westgotenreiches war nach dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 zunächst Toulouse. Nach der Schlacht von Vouillé 507 und dem Verlust fast aller gallischen Besitzungen wandten sich die Westgoten nach Hispanien. Toledo wurde zu ihrer Hauptstadt. Die Oströmer konnten das heutige Andalusien 554 noch einmal kurzfristig zurückerobern.
|
Mauren: Al-Andalus (ab 711) |
Eroberung der spanischen Halbinsel711 nutzten Araber und Berber aus der Region des heutigen Marokko den Bürgerkrieg im westgotischen Königreich auf der iberischen Halbinsel aus, um über die Straße von Gibraltar überzusetzen. Zuerst landete ein Expeditionsheer unter dem Offizier Tarif. Dieser ging mit 500 Mann westlich von Algeciras an Land, in der Nähe der später nach ihm Tarifa genannten Stadt. Tariq ibn Ziyad, der General des Kalifen, landete anschließend mit einem großen Heer bei Gibraltar (Dschebel al Tariq - "Felsen des Tariq"). Bei der Schlacht am Rio Guadalete (711) wurden die Truppen des letzten westgotischen Königs Roderich (Rodrigo) vernichtend geschlagen (s.o.). 714 setzte Tariq von Toledo aus die weitere Eroberung fort. Mit der Kultur der Eroberer konnte auch der Islam in Europa Fuß fassen. Der Fürst Abd al-Aziz wurde als Statthalter von Al-Andalus eingesetzt. Sevilla wurde zur Hauptstadt. Abd al-Aziz heiratete Egilona, die Witwe von König Roderich. 716 wurde Ayyub der Nachfolger von Abd al-Aziz. Er machte Córdoba zur Hauptstadt von Al-Andalus. 718 beherrschten die Araber den größten Teil der Halbinsel. Ausnahmen lagen im Nordwesten (Asturien, Galicien), wo westgotische Adlige den Widerstand organisierten.
|
Reconquista |
Der Widerstand gegen die einfallenden Muslime begann schon unter dem ersten König des Königreichs von Asturien. Don Pelayo (718 - 737) nahm den Kampf gegen die Mauren in den Bergen von Covadonga auf. Der Beginn der Reconquista ist umrankt von Mythen und Legenden, z.B. auch um Santiago (St. Jakob), den Maurentöter. Später führten die Söhne und Nachkommen Pelayos dieses Werk fort, bis die Muslime in Asturien besiegt waren. Währenddessen errichteten die fränkischen Herrscher im heutigen Katalonien die Spanische Mark und eroberten 785 Girona und 801 Barcelona zurück. Der verbreitete Gedanke, die Reconquista als einzelnen, 8 Jahrhunderte dauernden Prozess zu begreifen, ist historisch nicht haltbar. Die christlichen Reiche im Norden Spaniens kämpften sowohl gegeneinander als auch gegen die Muslime. Auch die Mauren waren kein homogenes Reich. Sie kämpften ebenfalls in wechselnden Allianzen mit und gegen die Christen oder andere Mauren.
Der spanische Volksheld des 11. Jahrhunderts, El Cid, wurde von König Alfons VI. aus Eifersucht und infolge von Intrigen verbannt und fand Zuflucht beim muslimischen König von Saragossa. Trotzdem breiteten sich in verschiedenen Phasen der spanischen Geschichte die christlichen Herrschaftsbereiche immer weiter nach Süden aus. Sie nutzten dabei oft die Zerstrittenheit der maurischen Seite. Im 15. Jahrhundert vereinigten sich die Königreiche von Kastilien und Aragón. Die Idee der Wiedereroberung durch einen Kreuzzug und das Bedürfnis religiöser Reinheit in ganz Spanien ist vermutlich nachträglich durch die "katholischen Monarchen" Isabella I. von Kastilien und Ferdinand von Aragón eingeführt worden. Damit rechtfertigten sie ihre Eroberung von Granada, die Vertreibung der Mauren und die Ausweisung der 160.000 Juden. Aragón war zu dieser Zeit schon länger eine wichtige Seemacht im Mittelmeer und Kastilien stand in Konkurrenz mit Portugal um die Vorherrschaft im Atlantischen Bereich. Nach der Übernahme der letzten maurischen Festung bei Granada im Januar 1492 begann Spanien, Missionen zur Erforschung der Weltmeere zu finanzieren. Die von Christoph Kolumbus brachte eine Neue Welt in den Blickwinkel europäischer Aufmerksamkeit. Es folgten Conquistadores, Eroberer, die die einheimischen Reiche in Mittelamerika und die der Inka unter spanische Herrschaft brachten. |
Herrschaft der Habsburger (1504-1700) |
Zwischen 1504 und 1700 herrschten Habsburger Könige und Kaiser über Spanien und seine Kolonien. Sie waren durch Heirat und fehlende Thronfolger der spanischen Herrscherlinie in Spanien an die Macht gekommen. Auf Reisen in Lateinamerika wundert man sich vielleicht, dass an alten Gebäuden oft der Habsburger Doppeladler zu sehen ist. Die Erbin der Katholischen Könige Fernando und Isabella heiratete Philipp aus dem Hause Habsburg. So gelangte die spanische Krone an das Haus Habsburg, das auf dem Höhepunkt seiner Macht auch die deutschen Kaiser stellte. So war z.B. König Carlos I von Spanien gleichzeitig Kaiser Karl V des deutschen Reiches. Informationen und Zeittafel zu den Habsburgern in Spanien siehe Extraseite > Habsburger auf den spanischen Thron |
Spanischer Erbfolgekrieg (1701-1714) |
| Im spanischen Erbfolgekrieg ging es um das Erbe des letzten spanischen Habsburgers, dem kinderlosen König Karl II. von Spanien. In der Folge gab es mehrere Kandidaten, die ihren Erbanspruch durch komplexe Verwandschaftsbeziehungen zu spanischen Herrschern und alte Vertragsinhalte zu rechtfertigen versuchten:
Letztlich ging es den europäischen Großmächten vor allem darum, das reiche Spanien zu kontrollieren bzw. der Kontrolle seiner jeweiligen Feinde zu entziehen. Gleichzeitig ging es um den Einfluss auf spanische Gebiete in den Kolonien oder in verschiedenen Fürstentümern in Europa. Betroffen waren da z.B. die spanischen Niederlande oder spanische Gebiete in Italien.
Für Frankreich ging es auch um die Beendigung der habsburgischen Einkreisung, die seit dem 16. Jahrhundert auf der französischen Agenda gestanden hatte. Auf der einen Seite stand die Haager Allianz mit dem österreichisch - habsburgischen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Preußen, Savoyen (nachdem es die Seite wechselte), Portugal, England / Großbritannien, den Niederlanden und weiteren deutschen Fürstentümern. Auf der anderen Seite stand Frankreich und seine Verbündeten Kurköln, Savoyen (bevor es die Seite wechselte) und das Kurfürstentum Bayern. Die Seemächte England und die Niederlande präferierten die Nachfolge durch den bayerischen Prinzen. Dies schien die einfachste Möglichkeit zu verhindern, dass die spanische Monarchie samt ihrer reichen Kolonien vollständig an Frankreich oder an die österreichischen Habsburger fiel. Die größten Kriegshandlungen fanden teilweise gleichzeitig im Süden des Heiligen Römischen Reichs, in Flandern und Brabant, in Oberitalien und Spanien statt. Der spanische Erbfolgekrieg entfachte aber auch an anderen Stellen Konflikte. Durch Unterstützung der Franzosen gab es im habsburgischen Reich (Ungarn, Siebenbürgen) Aufstände gegen die österreichische Vorherrschaft. Auch in den nordamerikanischen Kolonien kämpften 1702 - 1713 Engländer und Franzosen um die Vorherrschaft. Letztlich gelang es Frankreich, Philipp von Anjou als Philipp V. im Frieden von Utrecht und im Rastätter Frieden als König von Spanien durchzusetzen. Damit wurde die auch heute wieder amtierende Dynastie der Bourbonen in Spanien begründet. Fast alle an dem Krieg beteiligten Mächte hatten am Ende des Krieges zumindest Teilerfolge erzielt. Die Großmachtstellung Frankreichs blieb erhalten. Gleichzeitig begannen erste Versuche zu einer Aussöhnung mit den Habsburgern. Großbritannien war ein große Gewinner der Auseinandersetzung. Es gelang, die Kronen von England und Schottland dauerhaft zu vereinen. Wirtschaftlich war es gelungen, die eigene Seemacht zu festigen. Die wachsende Vormachtstellung im Welthandel konnte durch günstige Verträge mit Spanien und Portugal ausgebaut werden. Der Gewinn von Gibraltar (1704) war von extremer strategischer Bedeutung für die nächsten Kriege. Ebenso wichtig waren der Gewinn von Menorca und weiterer Gebiete in Nordamerika. Das Erzherzogtum Österreich gewann die wirtschaftlich wertvollen Provinzen der spanischen, nun Österreichischen Niederlande. Außerdem gab es Gewinne in Italien wie Mantua oder das Königreich Neapel mit Sizilien und Mailand. Spanien verlor seine italienischen Gebiete, u.a. Neapel, Sizilien und Sardinien. Außerdem gingen die Spanischen Niederlande, Menorca und Gibraltar in andere Hände. Der neue König Philipp V. setzte gegen den Widerstand der Provinzen das Modell eines zentralistischen Staates nach französischem Vorbild durch. Dadurch endete die Selbstverwaltung einiger Landesteile wie Katalonien oder das Baskenland. Die verwickelten Zusammenhänge erläutert der Artikel Wikipedia: Der spanische Erbfolgekrieg |
Beginn der Bourbonenherrschaft (1700-1788) |
Philipp V. (1700 - 1746): Der erste Bourbonenkönig französischer Herkunft, Philipp V., obwohl selbst von keiner großen Bedeutung, brachte doch aus seiner Heimat ein ganz anderes Regierungssystem und neue Kräfte in das zerrüttete Staatswesen. Die Fremden, Franzosen und Italiener, welche Philipp an die Spitze der Behörden und des Heers stellte, führten nun teils gewaltsam und in nur beschränktem Umfang die Grundsätze der französischen Staatsverwaltung ein: alle die einheitliche Staatsgewalt hemmenden Umstände wurden beseitigt. Handel und Gewerbe, Wissenschaft und Kunst wurden gefördert, die Privilegien der Provinzen aufgehoben, eine einheitliche Besteuerung und Steuererhebung eingerichtet. Die nützlichen Folgen einer zwar unumschränkten, aber tätigen und verständigen Königsmacht zeigten sich schnell. Aber als sie die Herrschaft der Kirche anfocht und deren Privilegien abschaffen wollte, stieß die Regierung beim Volk auf allgemeinen energischen Widerstand. Philipp V. gab nach. Der Klerus triuphierte, und die Kurie und die Inquisition herrschten nach wie vor in Spanien. Ferdinand VI. (1746 - 1759): Die Regierung des schwächlichen, hypochondrischen Ferdinand VI. war segensreich, weil sie sparsam und friedliebend war. In materieller Beziehung nahm das Land einen bedeutenden Aufschwung.
|
Karl IV und der Niedergang Spaniens (1788-1808) |
Karl IV. (1788 - 1808), ein gutmütiger, aber unfähiger Fürst, wurde ganz beherrscht von seiner klugen und entschlossenen Gemahlin Marie Luise von Parma. Diese brachte durch Günstlingswirtschaft und Verschwendung die Staatsverwaltung und die Finanzen in chaotische Zustände. 1792: Nach Beseitigung der fähigen Berater Karls III. verschaffte sie ihrem Geliebten Manuel de Godoy die oberste Leitung der Staatsgeschäfte. 1793: Spanien hatte dem Sturz der Bourbonen durch die Revolution in Frankreich untätig zugesehen. Es wurde aber durch die Hinrichtung Ludwigs XVI. und die Insulten des Konvents veranlasst, Frankreich den Krieg zu erklären. Dieser wurde mit einer so beispiellosen Unfähigkeit geführt wurde, dass er trotz der Schwäche der Franzosen mit einer französischen Invasion in Navarra, den baskischen Provinzen und Aragón endete. 1795: Die Gunst der Umstände verschaffte Spanien noch den vorteilhaften Frieden von Basel. Aber es geriet dadurch in völlige Abhängigkeit von Frankreich, die der leichtfertige Godoy durch den Vertrag von San Ildefonso (1796) besiegelte.
1797: Godoy zwang Spanien, das kaum die Kosten des letzten Kriegs hatte aufbringen können, in den Krieg mit England. Gleich die erste Schlacht beim Kap St. Vincent zeigte die Unbrauchbarkeit der spanischen Flotte. Dazu führte Godoy 1801 in französischem Interesse noch einen ruhmlosen Krieg gegen Portugal. Im Frieden von Amiens (1802) musste Spanien zwar an England nur Trinidad abtreten, aber seine Herrschaft in den amerikanischen Kolonien war erschüttert und seine Finanzen zerrüttet. Die misslungenen merkantilen und industriellen Revolutionen ließen das Land als Wirtschafts- und Weltmacht hinter Großbritannien, Frankreich und Deutschland zurückfallen. 1803: Trotz dieser Zustände stürzte Godoy durch einen neuen ungünstigen Vertrag mit Frankreich das finanziell erschöpfte Spanien in einen Krieg mit England. In diesem gingen bei Kap Finisterre (Galizien) und bei Trafalgar (Andalusien) die Reste von Spaniens mächtiger Flotte unter. Das Volk ließ dies alles geduldig über sich ergehen und wankte nicht in seiner unbedingten Loyalität zur Krone. Aber die Entrüstung richtete sich gegen den schamlosen Günstling Godoy, der in seinem Größenwahn sogar die Hoffnung hegte, Regent von Spanien zu werden oder sich die Königskrone von Südportugal aufs Haupt zu setzen. Als er, um Letzteres zu erreichen, sich 1807 mit Frankreich zu einem Krieg gegen Portugal verband, und Napoleon französische Truppen über die Pyrenäen in Spanien einrücken ließ, kam es am 18. März 1808 in Aranjuez zu einer Erhebung des Volkes gegen Godoy. Dieser wurde gestürzt. Unter dem Eindruck der Wut des Volkes ließ sich der König bewegen, zu Gunsten seines Sohnes Ferdinand, der noch ein Kind war, abzudanken. Als Ferdinand VII. hielt dieser am 24. März 1808 seinen Einzug in Madrid. Karl IV. nahm aber kurz darauf in einem Schreiben an Napoleon seine Thronentsagung, weil angeblich erzwungen, zurück. Der französische Kaiser bat nun die spanische Königsfamilie nach Bayonne, wo Ferdinand nach längerem Sträuben am 5. Mai 1808 auf die Krone zu Gunsten seines Vaters verzichtete. Dieser trat aber sofort seine Rechte an Napoleon ab. |
Napoleon, Unabhängigkeitskrieg, Ferdinand VII |
|
Carlistenkriege, Isabella II, Erste Republik, Restauration |
ab 1833: Nach dem Tod des Königs 1833 macht sein Bruder Don Carlos der Tochter Ferdinands und Maria Christinas, Isabella II., den Thron streitig. Da die Anhänger Don Carlos' - die Carlisten - Traditionalisten waren, suchte Isabellas Mutter bei den Liberalen Unterstützung. Dies führte zum 1. Carlistenkrieg, der nach sechs Jahren von den Liberalen gewonnen wurde. 1840 zwang ein erneuter, durch General Espartero durchgeführter Staatsstreich die Regentin Maria Christina zu Flucht. Espartero selbst übernahm danach die Macht. Nachdem Isabella 1843 für mündig erklärt worden war, führte General Narváez eine Revolte an, die General Espartero zur Flucht aus Spanien zwang. 1845 wurde eine Verfassung angenommen und zwei Jahre später, 1847 begann der 2. Carlistenkrieg, der 1849 mit dem Sieg Isabellas endete. Eine Reihe von Aufständen durch die Progresistas (Liberale, Republikaner und Sozialisten) und Moderados (Monarchisten und Katholiken) führte 1868 zu einer Revolution unter General Prim, die die Herrschaft von Isabella beendete und sie ins Exil nach Frankreich zwang, während General Serrano vorläufig die Regierung übernahm. 1869 wurde durch die Cortes eine erneute Verfassung proklamiert, die zu einer konstitionellen Monarchie unter Amadeus von Savoyen führte, einem Sohn von Viktor Emanuel II. von Italien . Der aufrührerische General Prim wurde 1870 ermordet. Nachdem 1872 der 3. Carlistenkrieg ausbrach und Amadeus die Ordnung in Spanien nicht wiederherstellen konnte, dankte er im Februar 1873 ab und die Cortes riefen die Erste Republik aus. Während der kaum elf Monate der Ersten Republik bekamen die vier Präsidenten der Exekutivgewalt (Figueras, Pi i Margall, Salmerón und Castelar), die jeweils nur einige Monate regierten, das Land ebenfalls kaum unter Kontrolle. Im Januar 1874 setzte ein Putsch von General Serrano der Republik de facto ein Ende: Serrano regierte als Diktator mit dem Titel eines Präsidenten; er löste die Cortes auf.
Durch einen Aufstand von Martínez Campos in Sagunt wurde schließlich im Dezember 1874 die Monarchie wiederhergestellt. Der Sohn Isabellas II., Alfons XII. aus dem Haus der Bourbonen, wurde neuer König von Spanien. Nach dessen Tod 1885 regierte seine Frau Maria Christina für den minderjährigen Alfons XIII.. Der 1876 beendete Carlistenkrieg und das Ende eines zehnjährigen Krieges auf Kuba läuteten den Beginn einer längeren friedlichen Zeit ein. Geprägt war die neue Epoche der "Restauración" durch ein faktisches Machtabkommen zwischen der Konservativen (deren Führer Cánovas del Castillo die Wiedereinsetzung der Monarchie maßgeblich unterstützt hatte) und der Liberalen Partei unter Práxedes Mateo Sagasta. Dies sicherte dem neuen konstitutionell geprägten Regime (eingeschränktes Wahlrecht mit Wahlmanipulationen, Machtbindung der interventionsfreudigen Streitkräfte durch Auslandseinsätze) eine anfängliche Stabilität unter dem Preis sozialer Ungerechtigkeiten. Die Ermordung von Cánovas del Castillo 1897, der Tod von Sagasta 1902 und schließlich die außenpolitischen Katastrophen (Spanisch-Amerikanischer Krieg 1898) heben diese Stabilität spätestens um 1900 auf. siehe auch: Carlismus bei Wikipedia |
"Desaster" von 1898: Verlust der Kolonien |
1898 verlor Spanien die meisten seiner kolonialen Besitzungen. Nachdem 1895 auf Kuba der Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen war, und sich auch auf den Philippinen nationalistische Gruppen erhoben, erklärte Spanien den Erhalt der Kolonien zur nationalen Frage. Bis 1898 entsandte die Regierung hunderttausende Soldaten, zumeist ärmlicher Herkunft, oft unvorbereitet nach Übersee. Eine mitunter drakonische Kriegsführung (Konzentrationslager auf Kuba, um die Landbevölkerung von den Rebellen zu isolieren) und das tropische Klima verursachten hohe Sterberaten unter der einheimischen Bevölkerung und der spanischen Besatzungsarmee. Die USA unterstützten die Rebellion, nicht zuletzt aus imperialen und wirtschaftlichen Erwägungen (91 Prozent des kubanischen Zuckers wurde in die USA exportiert). Bis 1898 gelang es den Rebellen indes nicht, militärisch die Oberhand zu gewinnen. Der Krieg belastete zunehmend die spanische Innenpolitik, die vom nationalistischen Hurra-Patriotismus der Zeitungen mitgeprägt wurde. Die Regierungen suchten nach einer Kompromisslösung in Form beschränkter Autonomierechte für Kuba und Philippinen, dies kam zu spät. Der Kriegseintritt der USA bewirkte eine rasche militärische Niederlage Spaniens ("El Desastre"). Kuba, die Philippinen und Puerto Rico wurden an die Vereinigten Staaten von Amerika abgetreten. Spaniens Kolonien beschränkten sich nur noch auf Enklaven in Marokko, der Westsahara und Äquatorialguinea. Die Niederlage bewirkte in Spaniens Bevölkerung einen Meinungsumschwung, literarisch prägte das "Desaster" eine Reihe von Schriftstellern und Künstlern, der so genannten "Generación del 98". Innenpolitisch verschärften sich die Spannungen zu Arbeitern und Bauern, deren ideologischen Überzeugungen sich radikalisierten (Stärkung sozialistischer und anarchosyndikalistischer Ideen). Die Unzufriedenheit der Armeeführung wurde durch neue Kolonialabenteuer zunächst abgelenkt: Gemeinsam mit Frankreich errichtete Spanien 1905/1911 ein Protektorat über Marokko, faktisch bedeutete dies die Inbesitznahme von Nordmarokko. Der zunehmend mit Reservisten und Wehrpflichtigen geführte Krieg führt 1909 zur Semana Trágica, einem Arbeiteraufstand in Barcelona. |
Weltkrieg I, Marokkokriege, Diktaturen |
ab 1914: Im Ersten Weltkrieg blieb Spanien neutral und erfuhr einen wirtschaftlichen Aufschwung (Rohstofflieferungen an die Kriegsmächte), an dem die breite Masse der Bevölkerung jedoch nicht partizipieren konnte. Das Regime wurde zunehmend schwächer, was sich nicht zuletzt am sich dahinschleppenden Marokko-Abenteuer abzeichnete. Die Unzufriedenheit darüber, dass leistungsorientierte Beförderungen von einem großen Teil des Offiziercorps abgelehnt wurden, bewirkt 1917 eine Staatskrise durch die "Juntas", die sich aus Festlands-Armeeeinheiten bilden und einen Regierungswechsel erzwingen. Zugleich bringt ein Generalstreik von Arbeitern und Sozialisten, insbesondere in Barcelona, das gesamte Regime ins Wanken. Marokko wird zum Prüfstein der konstitutionellen Monarchie. Der weitestgehend ohne parlamentarische Kontrolle durchgeführte "Befriedungs"-Feldzug gegen die Stämme des Rif bleibt ohne dauerhaften Erfolg. Bei einem Vorstoß kommt es 1921 unter General Silvestre zur militärischen Katastrophe in Annual, bei dem die marokkanischen Rebellen unter Abd el-Krim über 10.000 spanische Soldaten töten: Spanien verliert fast alle seit 1909 eroberten Positionen ausgenommen die Enklaven von Ceuta und Melilla. Die Niederlage macht die gesamte Ineffizienz der spanischen Militärorganisation publik. Die Mitverantwortung des Königs bleibt in dieser Angelegenheit undurchsichtig. Die sich danach zuspitzenden innenpolitischen Spannungen (23 Regierungen bis 1923) führen zur Diktatur von General Miguel Primo de Rivera, der König Alfons XIII. 1923 zustimmt. Die Verfassung von 1876 wird aufgehoben. Trotz einer zeitweilig breiten Unterstützung, auch unter Arbeitern und Intellektuellen (Straßenbau, Verwaltungs- und Steuerreform, Fachkabinett, Wiederherstellung der Herrschaft in Marokko und Frieden in einer kombinierten Operation mit Frankreich 1926), kann sich Primo de Rivera nur bis 1930 halten. Der General hatte immer wieder angekündigt, dass sein Regime nur ein Provisorium sei und es bald Wahlen gäbe. Diese blieben aber aus, sodass er schließlich durch General Berenguer ersetzt wird, welcher für den April 1931 Gemeindewahlen einberuft. Wegen der Verwicklung des Königs in die Diktatur ist das Ende der Monarchie auch absehbar. Bei den Gemeindewahlen können republikanische Kandidaten, benachteiligt durch die Wahlkreiseinteilung, zwar nur 1/5 der Sitze gewinnen, dies entsprach aber de facto 40 % der Stimmen und führte zur Ausrufung der 2. Republik. Der König verlässt das Land, ohne auf den Thron zu verzichten. Linktipp:Siehe auch Kurzbericht über das Leben des Mallorquiners > Juan March, der aus einfachen Verhältnissen kam, die Chancen auch der politischen Situationen nutzte und ein Familienimperium aufbaute. |
Zweite Republik (1931-36), Spanischer Bürgerkrieg (1936-39) |
Die Zweite Republik (1931 - 1936): Nachdem Alfons XIII. Spanien verlassen hatte, proklamierte der Großgrundbesitzer Niceto Alcalá Zamora die zweite Republik in der spanischen Geschichte. Gegen sie gab es anfangs kaum Widerstand und sie fand in großen Teilen der Bevölkerung Zustimmung. Alcalá Zamora wurde Staatspräsident, während eine Koalition aus linksrepublikanischen Parteien und den Sozialisten (PSOE) unter Manuel Azaña (Acción Republicana) die Regierung übernahm. Eine 1931 gegebene neue Verfassung gewährte Frauen das Wahlrecht und führte die Zivilehe ein. Katalonien und dem Baskenland wurden 1932 bzw. 1936 Autonomierechte gewährt. Es zeigte sich jedoch bald, dass die Republik die scharfen politischen und sozialen Konflikte schwer belasteten bzw. dass diese sich unter der neuen Regierung sogar weiter verschärften. Wirtschaftliche Probleme und Mangel an politischer Konsenskultur verhinderten eine dauerhafte Konsolidierung der neuen Staatsform. Wichtige Reformprojekte kamen nur zögerlich zustande, reformerische Gesetze wurden von Nachfolgeregierungen wieder zurückgenommen.
1932: Bereits im August kam es unter Führung General Sanjurjo zum ersten Putsch gegen die Regierung. Eine konservativere politische Ordnung sollte installiert werden. Der Putsch scheiterte jedoch. 1933: Nach den Wahlen übernimmt eine Mitte-Rechts-Koalition, bestehend aus der konservativen CEDA und dem liberalen Partido Radical unter dem neuen Ministerpräsidenten Alejandro Lerroux die Regierung. Gegen die neue Regierung kam es im Oktober 1934 zu verschiedenen Aufständen linker Gruppen. In Barcelona proklamierte die katalanische Regionalregierung ihre Unabhängigkeit, scheiterte damit aber ebenso wie die Anhänger des sozialistischen Gewerkschaftsführers Largo Caballero mit ihrem Aufstand in Madrid. Die größte Erhebung fand in Asturien statt, wo verschiedene Organisationen der Eisenbahner und Bergarbeiter eine "Arbeiterallianz" der sozialistischen Gewerkschaft UGT, den anarchosyndikalistischen Treinistas und den wenigen Anhängern der kommunistischen Partei PCE aus der Taufe gehoben hatten. Der Aufstand wurde von Regierungstruppen unter Leitung des Generals Franco niedergeschlagen, wobei etwa 3.000 Menschen ihr Leben verloren. 1936: Die Volksfront aus linksliberalen, sozialistischen und kommunistischen Parteien siegte bei den Parlamentswahlen im Februar. Die politische Instabilität, die von extremen Vertretern linker und rechter Positionen, ihrern paramilitärischen Verbänden, aber auch von Mitgliedern regulärerer Sicherheitskräfte geschürt wurde, verschärfte sich anschließend. Rechte Politiker bezichtigten die Wahlsieger der Wahlfälschung und behaupteten, Spanien werde in eine sozialistische Diktatur verwandelt. Während dieser Zeit kam es beinahe täglich zu Straßenschlachten und Anschlägen auf Persönlichkeiten des rechten und linken Spektrums. Schließlich nahmen führende Generäle die Ermordung des monarchistischen Oppositionsführers Calvo Sotelo durch Angehörige sozialistischer Milizen und der republikanischen Sicherheitspolizei zum Anlass, vier Tage später einen bereits geplanten Putsch durchzuführen. Der Putsch konnte die Regierung nicht unmittelbar stürzen, von ihr aber auch nicht unterdrückt werden. Er weitete sich mithilfe internationaler Unterstützung zum Spanischen Bürgerkrieg aus, in dem die Republik langsam unterging und vom Franco-Regime gewaltsam verdrängt wurde.
|
Diktatur unter Franco (1939-1975) |
Während des Zweiten Weltkriegs bleibt Spanien trotz seiner Sympathien für die Achsenmächte "nicht kriegführend". Im Gegensatz zur Neutralität bedeutet dies, dass Spanien Deutschland mit zur Verfügung gestellten Häfen (z.B. für die Versorgung der U-Boot-Flotte) und anderer Infrastruktur oder mit politischen Aktionen zur Seite steht. Franco war auch bereit, auf Seiten der Achsenmächte in den Krieg einzutreten. Er forderte von Hitler immense Mengen an Kriegsgerät und die Zusicherung, weite Teile des nordwestafrikanischen französischen Kolonialgebiets unter spanische Kontrolle zu bekommen. Konkrete Pläne wurden aber immer wieder abgesagt. U.A. wollte sich Hitler die Unterstützung des Vichy-Regimes in Frankreich nicht beschädigen lassen. Ein anderes Mal wurde ein geplanter gemeinsamer Angriff auf Gibraltar wieder abgesagt. England übte Druck auf Spanien aus, indem es die Besetzung der Kanarischen Inseln vorbereitete.
1941: Ein spanischer Freiwilligenverband, die sogenannte Blaue Division, wird an die Ostfront geschickt. 1943: Der anfänglich starke Einfluss faschistisch orientierter Kräfte (Falange) wird sukzessive vermindert. Franco muss die ihn unterstützenden Fraktionen wie Falange, Kirche, traditionalistische Karlisten, Monarchisten, Militär u.a. gegeneinander ausspielen, um die eigene Macht zu sichern. So entsteht durch die politische Stärkung der Kirche eine Art Nationalkatholozismus. Mit den militätischen Rückschlägen gegen die Achsenmächte zieht Franco sich von der Anbiederung an Hitler und Mussolini zurück und wendet sich den Aliierten zu. Er wechselt faschistische Minister gegen englandfreundliche aus und setzt später auf eine gemeinsame Allianz gegen den Bolschewismus, was im kalten Krieg sein Regime stabilisiert. 1953: Die außenpolitische Isolation, in die das Franco-Regime nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gerät, wird durch das Konkordat zwischen Spanien und dem Vatikan und durch das Stützpunktabkommen mit den USA durchbrochen. 1955 wird Spanien in die UNO aufgenommen. Nordmarokko wird mit Ausnahme von Ceuta und Melilla nach der Unabhängigkeit Marokkos zurückgegeben. Infolge des Spanischen Bürgerkriegs, der außenpolitischen Isolation nach dem Weltkrieg und infolge der eigenen autarkistischen und dirigistischen Wirtschaftspolitik gerät Spanien in den vierziger und fünfziger Jahren in eine tiefe Wirtschaftskrise. 1959: Diese Krise kann erst nach einer radikalen Reform der Wirtschaftspolitik (1959) überwunden werden. Das "Wirtschaftswunder", das Spanien wegen der neuen Wirtschaftspolitik in den sechziger Jahren erlebt, basiert auf dem Tourismus, auf den Überweisungen spanischer Gastarbeiter im Ausland und auf erheblichen ausländischen Investitionen. 1960er Jahre: Nachdem Mitte der vierziger Jahre die kleine anti-franquistische Guerillabewegung niedergeschlagen worden war, gibt es bis zu den Madrider Studentenunruhen 1956 keinen nennenswerten Widerstand gegen das Franco-Regime. Die traditionellen Gruppierungen der II. Republik wie die PSOE (Sozialisten) und Anarchisten (CNT) verlieren in den Jahren der Diktatur an Bedeutung. Der PSOE gelingt im Exil erst 1974 ein Neuanfang. Erst seit Beginn der sechziger Jahre formiert sich auf breiter gesellschaftlicher Basis ein starker Widerstand. Hauptkräfte des Widerstandes sind die Studentenbewegung, die von der Kommunistischen Partei PCE dominierten betriebsgewerkschaftlichen Arbeiterkommissionen, die katholische Arbeiterpriesterbewegung und die nationalen Kräfte in Katalonien und im Baskenland. Die Opposition erreicht zwar leichte Verbesserungen in der Pressegesetzgebung (1966) und bei der Wahl der Ständekammer, doch ist sie nicht in der Lage, einen Machtwechsel herbeizuführen. Dem Widerstand der Bauern- und Arbeiterschaft verschafft Franco mit der Auswanderungsmöglichkeit nach Mitteleuropa ein Ventil. Francos Staat ist paternalistisch ausgerichtet und auf seine Person fixiert, Historiker sprechen von Klerikalfaschismus. Traditionelle Werte (Familie, Kirche) sind von größter Bedeutung. Obwohl Franco als Militär der Armee die höchste Wertschätzung entgegenbringt, depolitisiert er sie konsequent: Seine Regierungen sind vorwiegend mit Fachzivilisten besetzt. Ab 1969: Die Jahre vor Francos Tod sind zunehmend geprägt von einer Verschärfung der politischen Repression, woran nicht zuletzt das Auftauchen der baskischen Untergrundorganisation ETA beiträgt. 1973 ermordet ein ETA-Kommando Francos starken Mann, Ministerpräsident Luis Carrero Blanco. 1970 werden Todesurteile der spanischen Justiz erst auf internationalen Druck hin in Freiheitsstrafen umgewandelt, doch 1974 werden der Anarchist Puig Antich und der DDR-Flüchtling Georg Michael Welzel mit der Würgeschraube (spanisch: garrote) hingerichtet. Wenige Wochen vor dem Tod Francos werden Todesurteile an fünf weiteren Regimegegnern vollstreckt. Kurz vor Francos Tod verliert das Land zudem durch die marokkanische Besetzung der Westsahara und die Unabhängigkeit Äquatorialguineas seine letzten kolonialen Besitzungen. 1975: Tod des Diktators. Franco fällt ins Koma, sein Leben wird von den Ärzten künstlich verlängert. Der seit 1969 feststehende Nachfolger, Prinz Juan Carlos, wird durch die Francoanhänger zum König proklamiert. Er spielt aber nicht mit und trägt aufgrund seiner verfassungsmäßigen und persönlichen Autorität wesentlich zu dem friedlichen Übergang des Landes zur Demokratie bei. |
Demokratie (ab 1978) |
Demokratie: 1978 nahm die spanische Bevölkerung mit 88%iger Mehrheit die Verfassung an, die Spanien zu einer parlamentarischen Monarchie machte. Putschversuch 1981: Angehörige der Armee und der Guardia Civil, die der Franco-Diktatur nachtrauerten, versuchen einen Militärputsch. Einer der Anführer, Tejero, stürmte das Parlament, wo Leopoldo Calvo-Sotelo gerade zum Regierungschef gewählt werden sollte. Die Mitglieder des Parlaments wurden als Geiseln gehalten. Mit dem entschlossenen Auftreten des Königs als Oberbefehlshaber der Armee, der sich im Rahmen einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache eindeutig für die Demokratie aussprach, konnte der Staatsstreich noch in der Nacht vereitelt werden. Dieses Datum wird von den Spaniern als der "23-F" (23. Februar) bezeichnet.
1982: Spanien tritt der NATO bei und richtet im selben Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft aus. 1986: Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft. 1992: Olympische Sommerspiele in Barcelona. 2002: Der Euro ersetzt die Pesete. 2003: Beteiligung am Irak-Krieg. Beim Irak-Krieg 2003 beteiligte sich die Regierung (PP, Aznar) aktiv am Zustandekommen des Feldzugs gegen Saddam Hussein. Zusammen mit Großbritannien und unter Führung der USA schloss man sich der so genannten "Koalition der Willigen" an. Deutschland, Russland und Frankreich argumentierten gegen einen Irak-Krieg. 2004: Madrider Zuganschläge und die politische Wende. Eine Serie schwerer Terroranschläge auf Nahverkehrszüge in Madrid erschüttert das Land. 191 Tote und ca. 1500 Verletzte wurden beklagt. Die konservative Regierung versuchte massiv, den Verdacht von Al Kaida (Zusammenhang mit der Außenpolitik der PP-Regierung) abzulenken und die Anschläge der ETA in die Schuhe zu schieben. Nur drei Tage später, am 14. März, fanden Parlamentswahlen statt. Die Manipulation der Medien durch die PP flog unmittelbar vorher auf. Entgegen allen früheren Umfragen gewann die Sozialistische Partei (PSOE) die Wahl. Damit verbunden kündigte sich ein Politikwechsel an. Innenpolitisch erhielten die nationalistischen Ansprüche in Katalonien und im Baskenland zunehmende Beachtung, während sich Spanien außenpolitisch wieder an das "alte Europa" Deutschland und Frankreich annäherte. Der Ministerpräsident zog die spanischen Truppen wegen der fehlenden UN-Resulution aus dem Irak zurück. Wenig später stockte er aber in Rücksichtnahme auf die Beziehungen zu den USA das Militärkontingent in Afghanistan auf. 2007: Rezession. Die Immobilienblase, die in Spanien besonders aufgepustet ist, platzt. Bist 2013 steigt die Arbeitslosenquote von knapp 9 auf über 27 %, bei den Jugendlichen auf fast 58 %. Hier rächt sich die Wirtschaftspolitik vor allem der PP, die den Bausektor und die Spekulation über die Maßen gefördert hatte. In der Folge versuchte die Regierung auf Kredit zahlreiche Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur. Die erhöhte Verschuldung (vor allem durch die PSOE-Regierung) führte aber kurz darauf zu einer immer weiter verschärften Sparpolitik (vor allem durch die PP-Regierung). Ab 2012 sinkt die Einwohnerzahl Spaniens (1900 = 18 Mio., 2012 = 47 Mio., Prognose 2052 = 42 Mio.) 2014: Nach mehreren Skandalen tritt der König Juan Carlos zurück, sein Sohn Felipe übernimmt. 2018 wird Ministerpräsident Rajoy (PP) nach einer Korruptionsaffäre gestürzt.
|