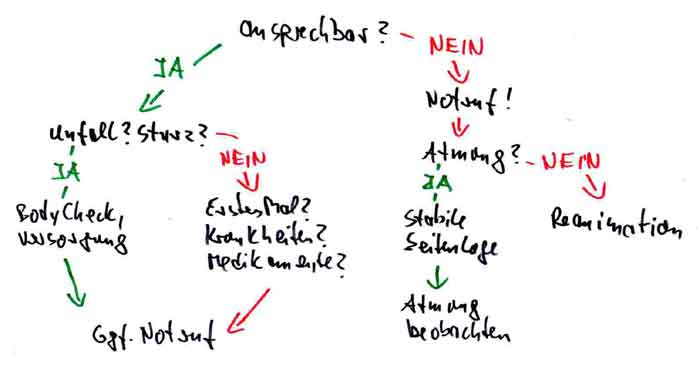Mittelbare und unmittelbare Wetterwirkung Mittelbare und unmittelbare Wetterwirkung
Bei den Wettergefahren unterscheidet man in der Theorie zwischen Gefahren, die den Wanderer unmittelbar bedrohen und Gefahren, die den Bergsportler indirekt gefährden.  unmittelbare Wettergefahren (Wirkung auf den Wanderer): unmittelbare Wettergefahren (Wirkung auf den Wanderer):
- Gewitter, Blitzschlag (direkter Schlag, Bodenströme)
- Nebel (Orientierung) (in Bergen häufiger, Wolken = Nebel)
- Kälte, Regen, Schnee, Wetterstürze (Unterkühlung, Erschöpfung, Erfrierung)
- Sturm (Seitendruck, Auskühlung)
- Hitze, Strahlung (Sonnenstich, Hitzschlag, Sonnenbrand, Schneeblindheit ...)
 mittelbare Wettergefahren (Wirkung auf Gelände, Ausrüstung etc.): mittelbare Wettergefahren (Wirkung auf Gelände, Ausrüstung etc.):
- Schnee, Eis: Vereisung, Glätte, schwierige Orientierung ...
- Nässe: Glätte auf Stein und Gras, Smartphone im strömenden Regen kaum nutzbar ...
- Kälte: Ausrüstung und Getränke gefroren ...
- Sonstige: Bachdurchquerung nach Regen oder Schmelze, Steinschlag, etc.

 Blitzschlag Blitzschlag
Blitzschlag gehört besonders in den Bergen zu den großen Gefahren.
Blitze können - räumlich wie zeitlich - auch deutlich vor oder nach einem Gewitter auftreten. 30-30-Regel: �Wenn der Abstand zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden beträgt, befindet man sich in der Gefahrenzone. �Erst 30 Minuten nach dem letzten Blitz oder Donner ist man wieder sicher.
 Unwahre Gerüchte: Unwahre Gerüchte:
Es gibt viele Gerüchte um das Thema Blitzschlag, von denen einige nicht stimmen:
- Ein Blitzschlagopfer zu berühren, ist gefährlich.�
- Ein Blitz schlägt nie zweimal in die selbe Stelle ein.
- Ein Blitz schlägt immer in das höchste Objekt ein.
- �
=> All dies stimmt nicht!
 Guter Schutz: Guter Schutz:
Einen guten Schutz vor Blitzschlag findet man an folgenden Orten:
- Hütte oder Haus mit geschlossenen Türen / Fenstern
- geschlossenes KFZ
- große Höhlen und Mulden (Abstand zur Wand mind. 1 m)
- steile Felswände (Abstand zur Wand mind. 1 m)
 Schlechter Schutz: Schlechter Schutz:
Einen schlechten Schutz bieten, auch wenn auf den ersten Blick anders zu erwarten, folgende Orte:
- Das klassische Zelt mit Satteldach und 2 Stangen: Die Stangen wirken wie Blitzableiter und führen bei Einschlag Strom. Ein Kuppelzelt ist besser. Es muss aber genügend Abstand zu Zeltwand und Gestänge bestehen (1-2 m).
- In offenen Unterständen kann man von Seitenblitzen getroffen werden.
- Kleine Nischen und Überhänge mit zu nahem Kontakt zur Wand sind problematisch. Der Strom läuft die Wand entlang und kann auf den Wanderer überspringen.
- Wasserführende Bachbetten: Wasser leitet den Strom besonders gut.
- Der Aufenthalt im Wald ist besser als auf freier Ebene. Herabfallende Äste sind aber auch sehr gefährlich. Kleine Lichtungen sind daher noch besser.
 Gefahr: Gefahr:
- einzelne Bäume
- Grate und Gipfel
- Drahtseile
- Stromleitungen, Seilbahnen, Skilifte
- Gegenstände über Schulterhöhe (z.B. Wanderstöcke, die vom Rucksack aufragen)
 Verhalten bei Gewitter Verhalten bei Gewitter
mit geschlossenen Beinen Kauerstellung einnehmen
Schrittspannung meiden
mit kleinstmöglicher Fläche den Boden berühren
isolierende Unterlage, evtl. auf trockenen Rucksack setzen
nicht flach hinlegen
Handys im Rucksack verstauen
Metallobjekte in sicherer Entfernung ablegen
kein Metall direkt auf der Haut (Verbrennungsrisiko)
Abstand von Wänden 3 m
Höhle: Abstand zur Decke 1 m, Abstand zum Eingang 1 m, Abstand zur Wand 2 m
Wenn man Kribbeln spürt und sich die Haare aufstellen: schnell mit geschlossenen Füßen in Kauerstellung gehen!
Elmsfeuer deuten auf unmittelbar bevorstehenden Einschlag hin
mehrere Personen nicht dicht zusammenstehen! Achtung: durch unkontrollierte Muskelkontraktionen oder Schockwelle des Blitzschlages besteht Absturzgefahr!
Viele Unfälle ereignen sich im Vorfeld von Gewittern bei übereiltem Rückzug. Trotz gebotener Eile: Ruhe bewahren!
 Nach dem Blitzschlag Nach dem Blitzschlag
Die häufigsten Todesursachen sind Herz- oder Atemstillstand. Durch Wiederbelebungsmaßnahmen können viele Betroffene gerettet werden, die dann meist wieder vollständig genesen. Also: Erste-Hilfe-Kurse auffrischen!
Manchmal ist der Puls da, und nur die Atmung fehlt: dann reicht künstliche Beatmung oft zur Wiederbelebung.
Rettungseinsätze bei Gewitter sind riskant, und werden daher oft nicht sofort durchgeführt.
Blitzopfer sollten auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus, da Folgekomplikationen auch noch Stunden nach dem Schlag auftreten können. Siehe auch > Wetterseminar  Unterkühlung Unterkühlung
Unter Unterkühlung versteht man ein starkes Absinken der Körpertemperatur.
Symptome sind Muskelzittern, schneller Puls und schnelle Atmung sowie schwindende Muskelkraft.
Unterkühlung gepaart mit Erschöpfung ist eine der häufigsten Todesursachen bei Bergwanderungen!
Unterkühlung kann bei ungünstigen Bedingungen schon bei + 10 Grad C auftreten (z. B. nach Verletzungen, Nässe ...).
Die erste Warnung, das Zittern, wird durch Alkohol häufig außer Kraft gesetzt. Außerdem verhindert Alkohol im Blut die körpereigenen Maßnahmen zum Wärmeerhalt. Daher ist Alkohol zum "Wärmen" absolut ungeeignet.
 Maßnahmen bei Unterkühlung: Maßnahmen bei Unterkühlung:
Schutz vor weiterer Auskühlung.
Aktive und passive Bewegungen vermeiden, keine Massagen, Transport so schonend wie möglich (Gefahr des Bergungstodes)!
Heiße, gezuckerte Getränke, kein Alkohol.
Atmung und Kreislauf beobachten.
Keine aktive Wärmezufuhr, keine heißen Bäder. Kaltes Peripherieblut darf nicht in den Körperkern gelangen! Das Wichtigste: Vorbeugung! (s.u.)
 Erfrierungen Erfrierungen
Erfrierungen sind meist lokale Zerstörungen von Körpergewebe durch Frost.
- Erfrierungen ersten Grades: Haut ist wachsweiss, kalt, gefühl- und schmerzlos. Kann durch Erwärmung (schmerzhaft) kuriert werden.�
- Erfrierungen zweiten Grades: Blasen, blaurote Haut. Tritt erst nach 2-3 Tagen auf.�
- Erfrierungen dritten Grades: nach mehreren Tagen: Haut wird schwarz und hart wie Porzellan. Betroffene Körperteile müssen amputiert werden.
Anfangs sieht jede Erfrierung aus wie eine erstgradige. Daher immer vom schlimmsten (3. Grad) ausgehen.
 Maßnahmen: Maßnahmen:
Erfrorene Stellen mit eigener oder fremder Körperwärme anwärmen. Nicht mit Schnee einreiben.
Benachbarte Körperteile (nicht die betroffenen Stellen) durch Massieren passiv bewegen.
Heiße, gezuckerte, salzreiche Getränke. Kein Alkohol!
Unterkunft suchen. In der warmen Unterkunft können heiße Alkoholgetränke gegeben werden.
Erneute Kälteeinwirkung unbedingt vermeiden!
Bei stärkeren Erfrierungen so schnell wie möglich zum Arzt.
 Wie schütze ich mich gegen wetterinduzierte Gefahren ? Wie schütze ich mich gegen wetterinduzierte Gefahren ?
Vorbereitung: Wetterbericht. Bei ca. 80 % der wetterbedingten Unfälle ist die Wetterprognose richtig (Vermeidbarkeit!).
Vorbereitung: Tourenplanung (wann, wo, Abbruchmöglichkeiten, Schutzmöglichkeiten etc.)
Ausrüstung: Kälteschutz, Regenschutz, Strahlungsschutz, Biwaksack, Orientierungshilfen (Kompass, Höhenmesser, GPS ...)
mit Ausrüstung immer auf der sicheren Seite sein!
Auf Wetterstürze und Zwangspausen vorbereitet sein!
Beobachtung: frühzeitig und laufend
Mental: sich Wettergefahren bewusst sein und mögliche Reaktionen vorher durchdenken (Angstlähmung vorbeugen!)
 3 Grundregeln !!! 3 Grundregeln !!!
Aktuelle Wettervorhersage für Tourengebiet einholen
Wetterentwicklung im Gebiet frühzeitig und laufend beobachten
Auf Wetteränderungen vorbereitet sein
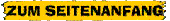
|