 Vegetation Vegetation
Die Bezeichnung Harz entstand im Mittelalter aus dem Begriff Harud, was so viel wie Wald bedeutet. Und der Wald ist auch heute wieder überall präsent. Natürlicherweise stehen in den Lagen bis zu 700 m Buchenwälder. Oberhalb dieser Höhe wurden sie von Buchen-Fichten-Mischwäldern abgelöst, die aber durch die Forstwirtschaft in den vergangenen 800 Jahren großflächig in Fichtenforste umgewandelt wurden.
1990 wurden im Osten und 1994 im Westen der innerdeutschen Grenze zwei Nationalparks ausgewiesen, die 2006 zu einer Gesamtfläche von fast 25.000 Hektar vereinigt wurden, das sind etwa 10 % des Harzes. Weitere Infos unter www.nationalpark-harz.de.
Durch die Einrichtung der Nationalparks und mit Hilfe von Lothar, Kyrill und anderen Stürmen sind die Fichtenmonokulturen wieder auf dem Rückzug. Die Trockenjahre 2018-2020 haben die Fichtenforste auch im Harz großflächig zerstört. Die durch Trockenheit, Luftverschmutzung und Borkenkäfer stark beschädigten Baumgerippe geben für manchen Betrachter ein düsteres Bild ab. Aber sie sind nur ein vorübergehendes und bald vergessenes Bild, denn zwischen den silbernen Fichtenruinen und umgestürzten Stämmen entsteht üppiges und artenreiches, gesundes neues Leben - wenn man es, wie im Nationalpark, lässt.
Gräser und Blütenpflanzen, Birken, Erlen, Eschen und andere Pioniere nutzen die nun wieder lichtdurchfluteten Flächen. Nach und nach entsteht im Nationalpark zwischen wilden Bachbetten und Granitblöcken ein naturnaher und gesunder Mischwald.
Außerhalb des Nationalparks liegt es am jeweiligen Waldbesitzer, ob wieder anfällige Fichtenplantagen oder gesunde Wälder entstehen.  Die Vegetationszonierung Die Vegetationszonierung
... des Harzes umfasst sechs Höhenstufen:
- Subalpine Stufe: Brockengipfel oberhalb 1000m
- Hochmontane Stufe: höchste Lagen mit Ausnahme des noch höher gelegenen Brockengipfels von 850 bis 1000 m
- Obermontane Stufe: höhere Lagen von 750 bis 850 m
- Montane Stufe: mittlere Lagen von 530 bis 750 m
- Submontane Stufe: untere Lagen von 300 bis 530 m
- Kolline Stufe: Lagen des Harzrandes bis 250 bis 300 m

 Wälder des Harzes Wälder des Harzes
 Buchenwälder Buchenwälder
Harzrand - 700 m Höhe:
Buchenwälder. In tieferen, trockenen Lagen dazu Eichen. Auf feuchteren Standorten Bergahorn.
In den lichtreichen Zerfalls- und Verjüngungsphasen spielen auch lichtbedürftige Pioniere wie Esche, Birke und Weide eine Rolle.
Durch das stärkere Kontinentalklima am östlichen Harzrand wird dort die Rotbuche von Eichen-Mischwäldern verdrängt.
 Buchen-Fichtenmischwälder Buchen-Fichtenmischwälder
Mittlere Lagen, 700 - 800 m:
Natürlich wären von Fichte und Rotbuche geprägte Mischwälder und Bergahorn. Diese sind meist reinen Fichtenbeständen gewichen, die aus wirtschaftlichen Gründen aufgeforstet wurden.
 Fichtenwälder Fichtenwälder
In den höchsten Lagen von etwa 800 m bis zur Waldgrenze bei 1000 m stehen Fichtenwälder, in denen auch Laubgehölze wie Ebereschen, Hänge- und Moorbirke sowie Weiden zu finden sind. Die hohe Luftfeuchtigkeit ist die Ursache für eine reiche Moos- und Flechtenflora. Trotz der Naturnähe findet man nur noch wenige heimische, genetisch angepasste Fichten. Statt dessen wurde mit sibirischer Fichte aufgeforstet. Auf frischen, aber keineswegs nassen und nur mäßig gesteinsreichen Böden gedeiht eine gut entwickelte Bodenvegetation, die vor allem durch Gräser geprägt ist.
Die Böden in den Hochlagen sind wie auch im überwiegenden Teil des gesamten Harzes vergleichsweise nährstoff- und basenarm, so dass nur wenige krautige Pflanzen vorkommen. Dafür sind es eher Farne, Moose, Flechten und Pilze, die neben der Fichte die Eigenart dieser Wälder bestimmen. Im Bereich verwitterungsresistenter Gesteine in der hochmontanen und montanen Stufe kommen häufig Felsen und Blockhalden vor. Aufgrund des Mangels an Erde gedeihen auf ihnen nur schwachwüchsige, sehr licht stehende Block-Fichtenwälder. Sie zeichnen sich durch einen besonders hohen Strukturreichtum aus und lassen mehr Raum für lichtliebende Arten wie Hänge-Birke, Eberesche, Bergahorn, Weiden und Zwergsträucher wie die Heidelbeere. Auch Moose und Farne sind hier häufig. In der Umgebung der Hochmoore auf Sumpf- und Moorböden finden sich die Moor-Fichtenwälder. Auf diesen Standorten können Fichtenwälder ausnahmsweise auch in tieferen Lagen die natürliche Waldgesellschaft bilden. Diese durch besondere Nässe geprägten Moorwälder weisen bereits einen hohen Anteil an Torfmoosen auf. Die Bodenvegetation kann aber auch durch ein reiches Vorkommen von Zwergsträuchern wie Preiselbeere geprägt sein.
 Sonderformen Sonderformen
Nur kleinflächig treten Schlucht-, Au- und Quellwälder auf. Die Rotbuche tritt hier zugunsten anspruchsvollerer Laubbaumarten wie Bergahorn, Linde, Ulme oder Esche zurück. Die Krautschicht ähnelt der von besser nährstoffversorgten Buchenwäldern.
 Hochmoore Hochmoore
Die Harzer Moore zählen zu den am besten erhaltenen Hochmooren Mitteleuropas. Sie entstanden am Ende der letzten Eiszeit vor über 10.000 Jahren. Die prägenden Pflanzen im Hochmoor sind die Torfmoose. Sie wachsen zuerst in den feuchten Senken, später dann immer höher bis sie als riesiger Schwamm ihre Umgebung überragen. Die Moose beziehen ihre Nährstoffe dann fast nur noch aus dem Regenwasser, entsprechend karg ist die Oberfläche. Hier halten sich nur wenige andere Pflanzen, häufig Relikte aus der Eiszeit, die sich sonst in der Tundra finden. Zwergbirke, Moosbeere, Heide, Wollgras und Sonnentau sind einige typische Vertreter. Größere Pflanzen haben hier keine Überlebenschancen. Entsprechend weit und offen wirkt die Moorlandschaft.
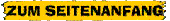
|



