 Pflanzenwelt in Fließtext
Pflanzenwelt in Fließtext
Die
Pflanzenwelt ist nordeuropäisch-alpin. Tundrapflanzen und Pflanzen,
die wir auch in den Alpen finden, prägen das Bild. Sie ertragen extreme
Bedingungen und eine kurze Vegetationsperiode (2-4 Monate). Die Vegetationsgrenze
liegt in der Höhe von 300 - 400 m.
Blumen, Gräser, Moose, Kräuter, Flechten, Beeren und Pilze
sind weit verbreitet.

Flechten gelten als die Pionierpflanzen an bisher unbesiedelten Standorten,
z. B. nach dem Rückzug eines Gletschers oder auf jungen Lavagesteinen.
Sie sind sehr genügsam, wurzellos und trockenresistent. Wasser wird
über die Oberfläche aufgenommen, fast alle Substrate (von Böden
kann man an diesen Standorten nicht sprechen) können besiedelt werden.
Flechten beginnen nach dem Winter früher mit dem Wachstum als andere
Pflanzen, wachsen aber sehr langsam. Die Geographenflechte kann zur Altersbestimmung
von Moränen herangezogen werden, sie braucht 60 Jahre für einen
Quadratzentimeter. Flechten werden sehr alt, über 4000 Jahre.
Bei den Blütenpflanzen findet man Anpassungen an Kälte, Wind
und Trockenheit, z. B. durch Rosetten- und Polsterwuchs. Sie schaffen
sich in ihrem eigenen Gesträuch ein günstiges Kleinklima, das
einige Grad wärmer sein kann als die Umgebung (Bsp. Stengelloses
Leimkraut). Reduzierte Blattflächen, dicke Blatthäute, flaumig
behaarte Stängel und Blätter sind ebenfalls Zeichen dieser Anpassung.
Sie geben Schutz gegen Feuchtigkeitsverlust und dienen als Wärmespeicher.
Blütenpflanzen meist mehrjährig. Silberwurz wird 100 Jahre alt,
aber nur 8-10 cm hoch. Viele Pflanzen sind lebend gebärend (Pseudoviviparie).
Sie bilden Brutknöllchen, in denen junge Pflanzen vorkeimen und dann
auf den Boden herabfallen (z. B. Knöllchenknöterich, Steinbrecharten,
viele Gräser).
Der Einfluss der Schneedecke auf die Flora ist oft entscheidend. Ist
sie zu niedrig gibt es zu wenig Schutz vor Kälte und Austrocknung.
Ist sie zu hoch resultieren lange Abtauzeiten und verkürzen die Vegetationsperiode.
Mit kurzen Vegetationsperioden kommen Krautweide, Moose und Flechten am
besten zurecht. Schneefreie Windblößen führen zu Zerstörung
durch verblasene Eiskristalle. Außerdem leidet die Pflanze dort
unter Kälte und Trockenstress im Frühjahr, da der Boden dann
noch gefroren ist, die Pflanzen aber schon voll der Sonne ausgesetzt sind.
Man findet zahlreiche Steinbrecharten und auch diverse Unterarten des
Leimkrauts. Stengelloses Leimkraut ist weit verbreitet und d as Aufgeblasene
Leimkraut ist eine der ersten Blütenpflanzen, die junge Lavafelder
besiedeln, und daher viel im Hochland zu finden.
Doldengewächse sind an feuchten Bachrändern und Seeufern verbreitet,
besonders beliebt ist der Engelwurz, den man traditionell auch zur Teeherstellung
und als Heilkraut kennt. Auf den Hofwiesen blüht viel Löwenzahn
und in den Bergen das Alpenröschen.

Die
im Juni in großer Menge violett blühenden Lupinen (vor allem
die Alaska-Lupine) wurden nach dem Zweiten Weltkrieg besonders auf Island mit Flugzeugen ausgesät
und sind daher an vielen Stellen zu finden. Sie fixieren mit ihrem dichten
Wurzelwerk den tonarmen und dadurch stark der Windverwehung ausgesetzten
Mutter- und Wüstenboden und dienen damit der Stickstoffanreicherung
und dem Kampf gegen die Erosion. Außerdem wurden Dünengräser,
vor allem Strandhafer, gesät, um der Winderosion zu begegnen.
An warmen Quellen und Bächen stößt man häufig auf
eine üppige Vegetation, vorausgesetzt die Beschaffenheit des Bodens
lässt dies zu. Die Erdwärme und das auf natürliche Weise
aufgeheizte Wasser nutzt man in Island auch für Gewächshäuser.
Aus diesem Grund wachsen knapp unterhalb des Polarkreises sogar Bananen
- die nördlichsten der Welt -, aber auch verschiedene Schnittblumen
und auch Weinreben werden hier gezüchtet.
 Island Island
- nur ein Viertel der Fläche Islands, ca. 25.000 km², sind bewachsen
- nur 1% davon sind bewaldet
- insgesamt gibt es nur 483 höhere Pflanzen – ca. ¼ des norwegischen Bestandes
- 560 verschiedene Moose
Auffallend für den Mitteleuropäer ist der Mangel an Wäldern.
Zur Zeit der Landnahme war dies anders, etwa 20 % des Landes waren
bewaldet, die alten Chroniken berichten gar, das Land sei "von der
Küste bis in die Berge" bewaldet gewesen. Vor allem traf man
ausgedehnte Birkenwälder an. Durch Nutzung für Feuerholz, Holzkohleproduktion
und Rodung zur Gewinnung von Weiden verschwanden diese Wälder jedoch
bereits in den ersten Jahrhunderten der Besiedlung. Die intensive Haltung
vor allem von Schafen ließ die Sprösslinge nicht mehr nach
wachsen. Nur spärliche Reste der niedrig wachsenden Moorbirkenwälder
überlebten, diese sind allerdings wunderschön und werden gern
von Isländern und Touristen besucht. In der Thorsmörk im Süden, am See Lögurinn/Lagarfljót
in Ostisland, dem Vaglaskógur (im Norden südlich von Akureyri)
sowie in den Westfjorden findet man noch ausgedehnte Waldflächen.
Sie bestehen aus Birken, Ebereschen und Wollweide.
Heute bemüht man sich um Wiederaufforstung des Landes. Vor allem
im Norden und Osten, aber auch in der Thorsmörk hat man hierbei schon
Erfolge erzielt.
Bauholz wird traditionell aus Norwegen eingeführt oder es werden geeignete
Stücke des Treibholzes zu allerlei Zimmer- und Tischlerarbeiten benutzt.
Letzteres stammt meist aus Sibirien, wo die großen Flüsse bei
ihren jährlichen Frühjahrsüberschwemmungen riesige Teile
der Taigabewaldung ins Nordpolarmeer reißen. Die Stämme treiben
dann mit dem Polarstrom nach Island.
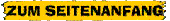
|
























